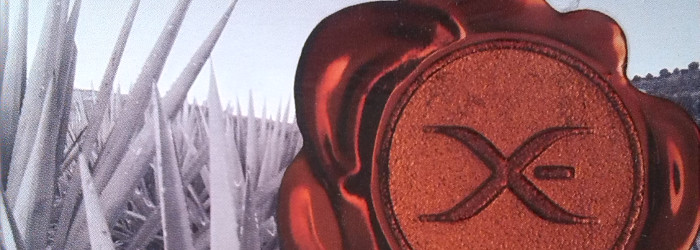Mein erster Kontakt mit Rakiya war vor Ort in Bulgarien, als ich mit den Jungs und Mädels von Spirits Selection by Concours Mondiale de Bruxelles 2018 in Plovdiv einige Zeit und Drinks verbringen durfte. Dabei lernte ich auch den Rakiya-Brenner Barash Musa kennen, und wir haben uns seitdem nochmal auf dem Flughafen in Amsterdam auf der mehr oder weniger gemeinsamen langen Reise nach China für die Folgeveranstaltung wiedergesehen. Auf der Rückreise drückte er mir völlig unerwartet eine Selektion seiner Rakiyas in die Hand. Feiner Kerl, das muss man sagen. Dabei war mein Gepäck schon zum Bersten gefüllt mit Baijius, doch so einen guten Stoff (das wusste ich damals schon), den muss man einpacken, dafür hätte ich auch eine Flasche Baijiu zurückgelassen, wenn es nicht anders gegangen wäre. Bitte ignorieren Sie einfach den Baijiu-Typen in der Mitte auf dem untenstehenden Foto. Der war zufällig auf dem gleichen Flug.

Zuhause angekommen, stellte ich die Samples von Rakiya Isperih (ракия Исперих) in mein Spirituosenregal, und, ich gebe zu, habe die Fläschchen aus den Augen verloren, weil immer irgendwas anderes dazwischen kam. Nun gehe ich das Thema aktiv an, schließlich habe ich bisher Zeugs besprochen, das es sicher nicht auch nur annäherend so wert gewesen wäre, mal einen Blick drauf zu werfen. Also wird nun ein Rakiya nach dem anderen ausprobiert. Das Set bestand aus 7 Sorten, in einem Kartontragerl verpackt, der die Reise aus dem Reich der Mitte leider überhaupt nicht überstanden hat. Doch das tut dem bulgarischen Obstbrand selbst natürlich keinerlei Abbruch. Wer noch keine Ahnung von Rakiya hat, dem empfehle ich die Lektüre dieses Artikels, geschrieben von Svetlin Mirchev, der Ahnung von der Materie hat wie kaum ein zweiter. Und ein cooler Typ ist er auch noch. Aber irgendwie sind alle Bulgaren, die ich kenne, coole Typen.

Beginnen wir, relativ willkürlich, mit dem Birnen-Rakiya (Крушова ракия). Nicht, weil er eine Silbermedaille bei eben jenem Wettbewerb gewonnen hatte, aber stören tut so eine Auszeichung natürlich nicht, ganz besonders weil ich weiß, dass hier echte Profis bewerten und verkosten. Ich mag die Frucht selbst im Allgemeinen und Birnenbrände im Speziellen einfach sehr, und freue mich über neue Interpretationen. Hergestellt wird er aus den Birnensorten Beurré Giffard und Santa Maria, die in Südwestbulgarien angebaut wurden. Farbe ist nicht vorhanden, der Rakiya ist makellos rein ohne Einschlüsse. Man spürt beim Schwenken eine gewisse Viskosität. Die Nase ist sehr klar und rein, Birne natürlich, ohne Fehltöne. Etwas Butter, wenn man tief riecht, sticht es etwas, ohne allerdings sensorisch Ethanoltöne zu haben. Der Antrunk ist superweich, sehr fett, mit viel Breite und Süße. Diese wandelt sich im Verlauf hin zu Würze, leichter Salzigkeit, und milder Trockenheit. 40% sind spürbar, das sollen sie in dieser Form aber auch sein. Der Abgang ist entsprechend feurig, ohne jedes Kratzen allerdings, Chili und Ingwer. Mittellang, mit schönem fruchtigen Nachhall. Das trinkt sich wirklich ausgesprochen angenehm und hat dabei gleichzeitig viel Birnencharakter. Ein hervorragend ausgeführter Brand mit toller Süßsauer-Balance.

Da kriegt man Lust auf mehr. Mal schauen, ob die anderen Früchte auch so schön ausgearbeitet sind. Gehen wir ohne viel Aufhebens zum nächsten über, dem Pflaumen-Rakiya (Сливова ракия). Auch hier erfährt man, welche Arten von Pflaumen eingesetzt wurden, nämlich Stanley und Chachanska lepotitsa aus dem Donautal im Nordosten Bulgariens. Ich sage es hier nochmal, später gehe ich nicht mehr darauf ein – wie alle hier besprochenen Rakiyas ist auch dieser kristallklar und ohne Einschlüsse, Fehler oder Trübungen, wie es sein soll. Wer Slivovitz kennt, einen sehr verwandten Brand, wird sich hier direkt heimisch fühlen. Süße Pflaumenaromen, sehr fruchtig, etwas Vanille, etwas Zimt. Ein wirklich schönes Bouquet, das der Pflaume als Frucht Rechnung trägt. Im Mund ist nach einem kurzen Süßschwall direkt ein bisschen mehr Würzigkeit und Feuer spürbar als beim Vorgänger; der Pflaumen-Rakiya wirkt schwerer und noch aromatischer, mit ordentlich Wumms, obwohl auch er auf 40% Alkoholgehalt eingestellt ist. Der Abgang ist warm, mittellang, aromatisch und effektvoll, vielleicht etwas flach im direkten Vergleich zum Vorlauf. Dennoch auch hier – eine wunderbare Interpretation eines Obstbrands.

Der nächste in der Reihe ist nun der Aprikosen-Rakiya (Кайсиева ракия). 8kg Frucht der Sorten Hungarian, Marculesti und Silistra aus dem Nordosten Bulgariens werden für eine Halbliterflasche angesetzt. Auch hier ist eine Silbermedaille von SSCMB vorhanden. Schöne Viskosität zeigt sich beim Schwenken, es bleibt schön viel am Glasrand hängen und läuft dann langsam ab. Beim Schwenken kommen die herrlich süßen, fruchtigen Aprikosendüfte dann schon in der Nase an, leicht esterig, etwas Klebstoff dazu. Minimalste Teernoten geben etwas Komplexität dazu. Aprikosen sind zwar natürlich das Basismaterial, aber ich meine auch Beinoten von Pfirsich und Kirschen zu riechen. Weich, mild und sehr fruchtig zeigt sich der Rakiya dann im Mund, sehr fruchtig, dazu eine spannende Zuckerwattekomponente, und feine Würze. Zitrusfrüchte, die dann in eine schöne, aufblühende, trockene, leicht grasige Floralität übergehen. Ein toller, endlos langer, blumiger Nachhall mit richtig viel Jasmin und einem Anflug von Wintergrünöl. Wow, ein wirklich ausgesprochen beeindruckender Abgang. Das ist ein sehr eleganter, kompatibler und einsteigerfreundlicher Rakiya – wer eine Chance hat, ihn zu probieren, sollte das definitiv tun.

Gehen wir nun zu einem Verwandten der Pflaume – der Mirabelle. Nancy-Mirabellen aus den Dörfern Belitsa und Yakim Gruevo wurden für den Mirabellen-Rakiya (Мирабелова ракия) verwendet. Inzwischen kann ich wohl sagen, dass sich diese Rakiyas optisch nicht voneinander unterscheiden, und auch nicht im Verhalten im Glas. Darum gehe ich direkt zu den Eindrücken über, die meine Nase sammelt. Der Mirabellen-Rakiya hat etwas leicht Parfümiertes, leicht blumig, leicht fruchtig, und so ein Anklang von Gewürzen, Nelken und Piment vielleicht. Etwas Ethanol riecht man hier durchaus durch, aber nur im Unterbau. Im Mund wirkt er nicht ganz so süß wie seine Vorgänger (aber genauso fett und breit), er beginnt schon würzig-trocken, edel herb und weniger fruchtig als erwartet. Am Gaumen ist er sehr effektvoll, piekst ein bisschen, und geht dann sogar leicht über ins Scharfe. Der Abgang ist mittellang, eiskalt mit Eukalyptushauch, und leicht blumig. Durchaus unerwartet im Gesamtbild, das ist etwas völlig anderes als beispielsweise der Aprikosen-Rakiya – der Mirabellenbrand ist was für Männer, heißkalt, würzig. Spannend, wie man im Direktvergleich die Unterschiede massiv wahrnimmt.

Ich mag Kirschen sehr, eine der Früchte, auf deren Saison ich mich immer freue. Mit entsprechend viel Spannung habe ich mir also den Kirsch-Rakiya (Черешова ракия) eingegossen. Hergestellt wird er aus Süßkirschen der Sorten Bing, Van, Cordi und Lambert aus den Regionen Plovdiv und Isperih. Ein weicher, milder, fruchtiger Geruch verbreitet sich direkt schon beim Eingießen ins Glas. Süßkirsche, Marmelade, Johannisbeere, ganz vorsichtige Gewürze wie Nelken und Kardamom. Toll, sehr aromatisch und voll. Im Mund dann sehr trocken vom Antrunk an, dezente Frucht, nur wenig Süße. Sehr klar im Mundgefühl, die Kirsche baut sich erst Stück für Stück auf, mit viel Gewürz und leisem Feuer. Leichte Parfümnoten, floral und bunt. Das ist gar nicht so fruchtig wie erwartet, dafür aber extrem trinkbar, sehr süffig, das macht richtig Spaß. Der Abgang ist mittellang, warm, klar und streng. Im leeren Glas verbleiben sehr aromatische Frucht-Blumen-Noten. Da bekomme ich direkt Lust, mir ein zweites Glas einzugießen, das ist gefährlich leicht zu trinken. Im Nachhall kommt dann die Kirsche vollends zur Blüte mit leichter Bitterkeit und einer sehr angenehmen warmen Fülle im Mundraum. Oh, das gefällt mir sehr.
Wir nähern uns dem Ende, der vorletzte Brand der Reihe beschäftigt sich mit dem Pfirsich. In Südzentralbulgarien ist das Wetter scheinbar passend genug, um dort Pfirsiche der Sorten Hale, Red Haven und Glohaven anzubauen. Diese können meiner Meinung nach eigentlich kein besseres Schicksal erleiden, als im Pfirsich-Rakiya (Прасковена ракия) zu landen. Die Nase ist sehr vanillig, fruchtig, leicht buttrig. Etwas milder Weinessig vielleicht, und ein Anflug von Milchschokolade. Rein vom Geruch hätte ich gesagt: der ist gereift; ist er aber nicht, hat dennoch Reifungsnoten. Im Mund kommen genau diese Eindrücke auch vor. Sehr süß ist er, und hat ein sehr fettes, buttriges Mundgefühl. Leider fällt er im Vergleich zu allen bisherigen Proben bezüglich Aromenreichtum und Komplexität deutlich ab, da bin ich überrascht, aber es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn dieses extrem hohe Niveau komplett durchgehalten werden würde. Der Abgang ist kurz, würzig, mildwarm, und vergleichsweise aromenarm, etwas Grasiges-Kiesiges hat er noch. Schade, aber das ist dann wohl der Ausreißer, den wir zugestehen müssen.

Zu guter letzt wenden wir uns einer Frucht zu, die einen sehr gemischten Ruf hat. In letzter Zeit erfährt sie, so habe ich den Eindruck, im Zuge des geweckten Interesses an nichtalltäglicher Nahrung etwas an Aufwind. In Spirituosen wird sie eigentlich immer gern eingesetzt, weil sie als Speiseobst nicht besonders begehrt ist – die Quitte. Die alten bulgarischen Sorten Asenitsa und Pazardjik aus der Region Dobrich scheinen gut geeignet, weil sie klein und weich sind. Was macht der Obstfreund aus ihnen? Natürlich einen Quitten-Rakiya (Дюлева ракия). Leichte Weißweinnoten, etwas Apfel, Apfelessig dazu, Bergamotte und schließlichen einen Batzen dieser sehr prägnanten Quittenfrucht. Hell, leicht, aber mit Körper, so meint die Nase. Im Mund wirkt der Quittenbrand plötzlich überraschend stumpf dagegen, doch das ist nur der erste Eindruck. Von dieser Stumpfheit aus entwickelt sich die Quitte wirklich sehr deutlich, wuchtig und aromatisch. Schwersüß, gleichzeitig sehr würzig, mit milder Ingwerschärfe. Gegen Ende wird dieser Rakiya sehr anästhesierend und pieksend, der Nachhall ist mittellang und heiß, im ganzen Mundraum spürbar, mit etwas Pfeffer am Ende. Spannend, weil ich persönlich nicht so wirklich viele Quittenbrände kenne – es ist wirklich etwas anderes, und sowas liebe ich ja immer.

Nach der Verkostung der 7 Sorten weiß ich, dass Brenner Barash Musa nicht nur ein feiner Kerl ist, sondern sein Handwerk auch beherrscht. Die Früchte sind fehlerlos gebrannt, klar definiert und sehr prägnant ausgearbeitet, tolle, saubere Destillate mit viel Charakter und sehr hoher Typizität. Ich mag darüber hinaus den eher zum Süßen, Schweren tendierenden Stil des bulgarischen Rakiya, er sorgt dafür, dass die ganze Frucht erkennbar bleibt und man wirklich was im Mund hat, und nicht nur ein steriles Destillat. Persönlich für mich der Gewinner dieses Sets ist der Aprikosen-Rakiya – das ist aber ein Sieger unter Siegern. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass dieses Destillat in holzgereifter Variante auch eine Spirits-Selection-Goldmedaille gewonnen hat. Wundert mich nicht.
In Drinks kann man die Rakiyas natürlich hervorragend in Szene setzen. Obstbrandrezepte an sich sind seltsamerweise eher selten, vielleicht brauchen sie auch den Schubs, den Scotch brauchte, um ihn aus seinem elitären Wolkenkuckucksheim zu holen und ihn fürs Vermixen freizugeben. Bulgarian Spring ist ein Cocktail, der im Zuge der Spirits Selection in Plovdiv als „Visitenkarte“ für die Veranstaltung kreiert wurde – ein fantastisch aromatisches Rezept, ich habe dafür den Pfirsichrakiya benutzt, andere gehen aber genauso gut.

Bulgarian Spring
1 Stück Gurke
2 Zweige Thymian
3 weiße Weintrauben
2 Teelöffel brauner Zucker
…zusammen muddeln
1½ oz bulgarischer Rakiya
½ oz Zitronensaft
1 Eiweiß
Auf Eis shaken.
[Rezept nach Filippo Baldan]
Ich fände es großartig, die bulgarische Connection aus Barash, Elena, Darko und Svetlin auch 2020 wiederzusehen, wenn es klappt, auch für meinen vierten Auftritt bei dem Spirituosenwettbewerb eingeladen zu werden. Bis dahin vertreibe ich mir die Zeit mit den Resten Barashs Rakiyas, und den anderen Sorten, die ich damals aus Bulgarien mitgebracht hatte. Man kann die Zeit echt sehr viel schlechter verbringen.