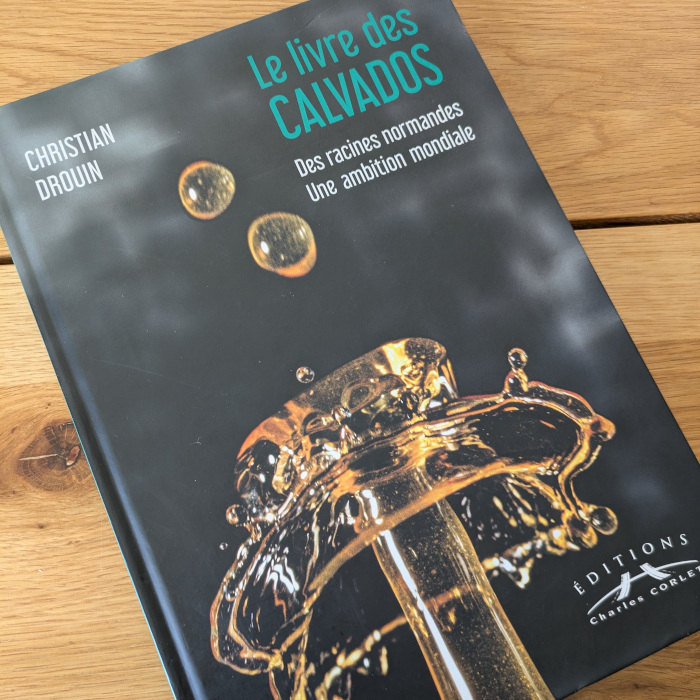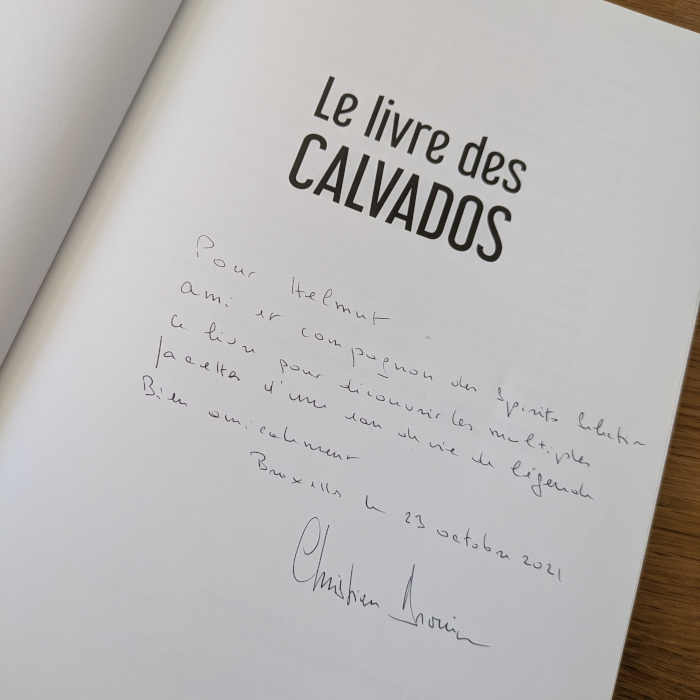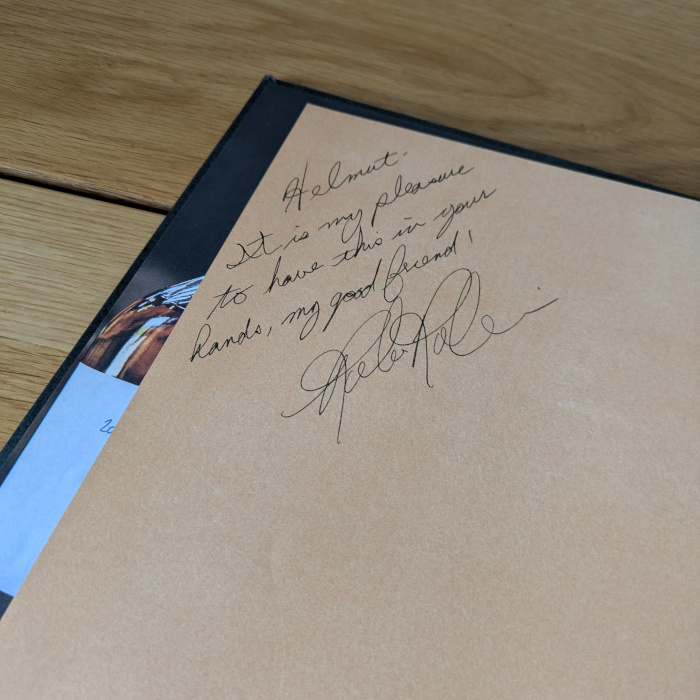Meine Schwägerin Judith macht selbst Wermut, und versorgt mich regelmäßig mit ihren hausgemachten Produkten. Seitdem habe ich nur selten kommerziellen Wermut gekauft, der selbstgemachte ist so aromatisch und besonders, dabei ganz klassisch und wirklich kräuterlastig, dass es die oft eher milden italienischen und französischen Wermuts etwas schwer haben; insbesondere, wenn es um den Einsatz in wuchtigen, kräftigen Cocktails geht. Ich würde ihr ja empfehlen, diese tollen alkoholischen Produkte zu vermarkten, ich denke, ich wäre sicher nicht der einzige, der so etwas zu schätzen weiß. Bis es soweit ist hat der geneigte Wermutfreund ja trotzdem eine große Auswahl, und dank der sehr rührig arbeitenden Solveig Gerz-Stamenkovic finden wir hierzulande auch in dieser Kategorie inzwischen exotischere Produkte, wie den William Hinton Moot Vermute Meio-Doce.
Für diesen halbtrockenen, roten Wermut, der als der erste authentische Wermut von der autonomen Region Madeira, zugehörig zu Portugal, beworben wird, werden aromatische Kräuter von der Insel und Gewürze gereiftem Madeira-Wein beigefügt, also wirklich im wahrsten Sinne ein Kind der Insel. Er stammt von Engenho Novo da Madeira, die der geneigte Rumfreund ja bereits kennt (oder kennen sollte). 14,5% Alkoholgehalt weist er auf, und ich bin immer gespannt, neue Ausprägungen eigentlich ganz traditioneller Kategorien ausprobieren zu dürfen; man findet oft überraschende Besonderheiten in ihnen. Vielleicht hat der William Hinton Moot auch so eine in Petto?
Gebrannte Siena sehen wir im Glas nach dem Einschenken, mit leicht rubinrötlichen Lichtreflexen, wenn man das Glas ins Gegenlicht hält. Beim Schwenken entstehen direkt fette Schlieren an der Glaswand, die Flüssigkeit schwappt schwer und sehr ölig, das beeindruckt schon beim Zuschauen.
Apart ist aber auch die Nase – zunächst gefällt eine sehr angenehme, ausgeprägte und trotzdem nicht überschwängliche Fruchtigkeit, rote reife Trauben, milde Grapefruit, gekochte Ananas und Brombeerkompott. Weich, rund, voll. Darunter findet man aber schnell die Komplexität von edler Nussigkeit, viele Walnüsse und ein paar Mandeln eingestreut. Leichte Sandelholztöne kommen dazu, in toto ergibt das ein wirklich schönes, rundes Aromabouqet, an dem man gerne und lange verweilt.
Hauptsächlich die Frucht transferiert dann auf den Gaumen, deutlich säuerlicher als die Nase ankündigte, die Beeren, die Grapefruit und die Trauben wirken dennoch voll. Die Textur zeigt sich weiterhin fett und expansiv, sie sorgt dafür, dass die Säure sich nicht zu dominierend verhält. Im Verlauf bringen erdige und holzige Töne Abwechslung, die Walnuss kommt zum Zuge, und insgesamt dreht sich der Eindruck mehr ins Trockene, erinnert im Nachhall fast an einen ganz milden Amontillado, wenn die fruchtigen Obertöne verklungen sind. Sanfte Astringenz zieht einem etwas die Spucke weg, und eine durchaus maritime Salzigkeit erscheint ganz spät und komplettiert ein vielschichtiges und unterhaltsames Bild.
Komplex, vollaromatisch und sauber strukturiert, was will man mehr von einem halbtrockenen Wermut. Die Kräuter, die ich normalerweise stärker erwarten würde, gehen vielleicht stellenweise etwas unter gegen die Frucht, doch es fühlt sich nie falsch an, was man da trinkt, sondern stark, kräftig, und dennoch eher ein Rapierfechter denn ein Säbelschwinger.
Die Trinkempfehlung auf der Rückseite der Flasche geht hin zum Purgenuss, auf Eis und mit einer Orangenzeste. Das funktioniert sicher, wer etwas mehr Aufwand betreiben möchte, kann sich die Kreation von Kai Dietrich aus dem La Boutique Trinkkultur Café & Bar in Neustadt an der Weinstraße ansehen; Kai kombiniert hier einen Zuckerrohrsaftrum aus Madeira mit diesem Wermut und Pampelle Ruby, einem Grapefruit-Bitter. Der Madeironi ist auf dem Papier klar als Negroni-Twist erkennbar, zeigt sich im Geschmack aber klar unabhängig von seinem Vorbild.


Madeironi
60ml Rum Agricola da Madeira
60ml Moot Vermute
40ml Pampelle Ruby
Auf Eis rühren. In ein gefrostetes Glas mit einem großen Eiswürfel abseihen.
Mit einer Orangenzeste servieren.
[Rezept nach Kai Dietrich]
Die Braunglasflasche fasst die leicht ungewöhnlichen 750ml, und ist mit einem Echtkorken versehen. Die Gestaltung hält sich sehr zurück, rein buchstabengeführt, direkt auf die Flasche aufgedruckt.
Madeira hat offensichtlich viel zu bieten, nachdem ich schon diverse Rums von dort probieren konnte (und hier besprochen natürlich, man suche einfach nach dem Schlagwort „Madeira“), und auch einen Premix-Poncha, fehlt für mich nur eins: Ein Besuch der Insel. Dies steht natürlich auf meiner Bucket List, und ich hoffe ehrlich, irgendwann mal dort hinkommen zu können, idealerweise in angenehmer Gesellschaft und mit Besichtigung der Brennereien. Bis dahin trinke ich aber sicher noch den einen oder anderen Madeironi.
Offenlegung: Ich danke Solveig Gerz von FFL – Spirit Brands für die kosten- und bedingungslose Zusendung einer Flasche dieses Wermuts.