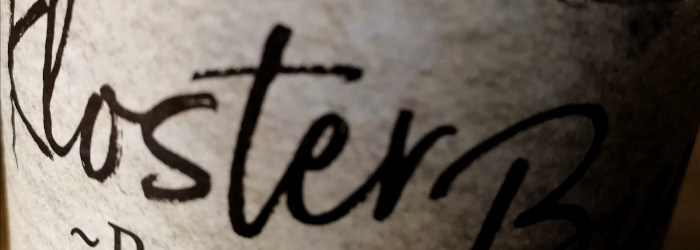Berliner Weiße, eine aussterbende Biergattung. Nur noch eine Handvoll Marken gibt es überhaupt, und der Eindruck in der breiten Bevölkerung ist, dass das ein grünes oder rotes Biermischgetränk ist, mehr ein Spaß für Zwischendurch denn ein ernstzunehmender Bierstil. Um 1900 gab es in Berlin 200 Brauereien, die die Weiße herstellten, und sie wurde in über 700 Gaststätten gewohnheitsmäßig ausgeschenkt – davon blieben nach den Weltkriegen eine in Ost- und 5 in Westdeutschland übrig, bis 1992 mit Schultheiß die letzte schloss und die Berliner Weiße in der Breite damit der Vergangenheit angehörte. Die Diplomingenieurin Ulrike Genz hat sich mit ihrer Kleinbrauerei Schneeeule seit 2016 das Ziel gesetzt, diesen traditionellen Berliner Bierstil eben nicht aussterben zu lassen, der verwandt ist mit Geuze, Lambic und Gose (letzterer hat ja ein ähnliches Zukunftsproblem). Ende 2023 bot sie eine Onlineverkostung mit 6 ihrer Biere an, bei der ich natürlich gern teilnahm, und meinen Leser will ich heute ein bisschen einen Einblick geben, was da so vorgestellt wurde.
Was ist eine Berliner Weiße eigentlich? Es gehört in die Kategorie Sauerbier, ist auf Weizenmalzbasis gebraut und die Säure entsteht durch Milchsäuregärung mittels Lactobacillus und Brettanomyces, die Kenner kennen diese kleinen Racker natürlich. Eine Flaschennachreifung gehört dazu. Die verwendeten Mikroorganismen wurden teilweise aus alten Weiße-Flaschen, die Genz noch auftreiben konnte, gewonnen, man bekommt bei Schneeeule also schon ein Stück Biergeschichte mitgeliefert. Schneeeule macht ausschließlich diese Art Biere, weil die Brauerei durch diese lebendigen Mikroorganismen komplett „durchinfiziert“ ist und alle anderen Biere angesteckt und dadurch auch sauer würden; die Biere von dort sind allesamt unfiltriert und unpasteurisiert, denn das würde ja die Lebewesen abtöten und entfernen, die für die Weiterreifung notwendig sind. So, genug Theorie, rein ins Glas mit der Weißen!
Das Schneeeule Marlene bildet die Basislinie, natürlich. Eine traditionelle Berliner Weisse, wie es früher in der Hauptstadt üblich war. Leicht blasse Maisfarbe, dabei volltrüb bis zur Blickdichte. Es knistert zwar beim Eingießen, doch der dabei entstehende Schaum verschwindet praktisch sofort. Ganz leichte Perlage ist erkennbar. Die Nase zeigt fruchtigen Apfelessig, Verjus vielleicht, mit einer sehr ausgeprägten Würze, die die Säure auffängt und spannend macht. Federweißer und Viez sind die nächsten Assoziationen, die mir einfallen. Auch bei der kühlen Trinktemperatur durchaus expressiv! Am Gaumen springt einen sofort eine knackige Säure an, so richtig limettig, mit schönem Fruchtcharakter aus ätherischen Zitrusölen. Dabei ist eine gewisse Grundsüße als Ausgleich da, die als Körper das Volumen bringt, um das nicht zu kantig werden zu lassen. Die Marlene kribbelt etwas auf der Zunge, ist minimalst astringierend, ohne wirklich trocken zu wirken, erst im Abgang gibt es ein ganz dezentes Kratzen im hinteren Rachen. Ein Anflug von tropischer Frucht, erneut die klare Verbindung zu mildem Essig, und am Ende auch etwas brotig-hefiges lassen doch einiges an Komplexität aufblitzen, während man bei so einem Sauerbier über Rezenz gar nicht reden muss. Wer Sauerbier so nicht kennt, wird das blind nicht für ein Bier halten, da bin ich mir sicher. Der Sauerbierfreund dagegen findet hier ein wunderbares, würzigsaures Bier, für das man keinerlei Sirup braucht, um es gemütlich genießen zu können.
Länger und aktiver ist der Schaum dann auf dem Schneeeule Kennedy, auch teilweise durch die stärkere Perlage. Die Farbe geht hier ins blasse Eidotter über, das vollständig trüb ist, winzige Hefepartikel landen beim Eingießen im Glas. Die Nase ist deutlich hopfig, mit viel Aromen von Fruchtmarmelade, Grapefruit, Himbeeren und gerade reifer Ananas. Leichte Säure erahnt man mehr als dass man sie wirklich erriecht, sie ist deutlich mild und eher mildzitronig. Eine gewisse Würze ist erkennbar. Das Bild geht im Mund so weiter, eine Pale-Ale-Weisse, würde ich sagen – ein Hybridmodell, das sehr gut funktioniert. Zitrone im Antrunk, Grapefruit im Verlauf, eher Fruchtsäuren als Essigsäuren in meinem Gefühl. Dadurch, und die gute Karbonisierung, ist das eine Rezenzbombe, gut gekühlt erfrischt das wirklich herrlich, ohne eine leichte Cremigkeit in der Textur zu verlieren. Der Abgang ist sehr kurz und leicht, mit 3,5% Alkoholgehalt trinkt sich das extrem süffig und easy.
Leicht aromatisiert wird das Schneeeule Yasmin, der Name deutet es natürlich schon an, Jasminblüten kommen hier zum Einsatz. Die Farbe hält sich erneut ans Eidotter, ist nur trüb und blickdicht, wenn man die Flasche beim Eingießen etwas schwenkt, um den Bodensatz zu lösen. Schaum ist absolut null komma null vorhanden, nichteinmal einzelne Bläschen sieht man. Geruchlich nehme ich den Jasmin zunächst allerhöchstens ganz am Rande wahr, die frische Säure übertönt das meiste andere. Etwas Hefe kommt vor. Ein herber Gesamteindruck für die Nase. Am Gaumen haut einen die Milchsäure dann so richtig weg, das ist zitronig und limettig ohne jede ausgleichende Süße, so dass die saure Seite voll auf den Gaumen trifft. Da muss ich die Augen teilweise zusammenkneifen, so drastisch sauer ist das, sicherlich das sauerste Bier, das ich je im Glas hatte. Der Geschmack zeigt auch nur wenig Jasmin, auch hier mehr ein zarter Eindruck im Hintergrund. Wäre da die herbe Würze im Abgang nicht, könnte man meinen, puren Zitronensaft zu trinken. Wahrscheinlich sind die unterschiedlichen Chargen bezüglich dem Jasmin anders ausgeprägt, wenn es nicht auf dem Etikett stünde, ich hätte es nicht gefunden. Dennoch ist das ein unterhaltsames Sauerbier, das zeigt, wie extrem der Stil werden kann.
Etwas eigentlich völlig verrücktes haben wir nun im Glas – der Schneeeule Gurkenkaiser nimmt die Region um Berlin mit ihren Gurkenfeldern zu sich ins Boot. Pastellgold, blass, blickdicht, das grundsätzliche Muster bezüglich der Optik bleibt erhalten. Auch, dass sich kaum Schaum bildet. Zutaten neben den üblichen sind eben die Spreewälder Gurken und dazu passende Dillblüten, hier gehen wir leicht hoch mit 3,7% Alkoholgehalt. Man könnte gefühlt auch an einem Glas eingelegter Essigkurken riechen statt an diesem Bier, finde ich. Das ist gar nicht negativ, im Gegenteil, ich mag eingelegtes Gemüse sehr. Der Dill ist allem voran, dahinter kommen durchaus auch fermentierte Gurken, wie ich sie als Kovászos Uborka aus Ungarn kenne. Darunter kommt etwas Zitrusfrucht, und diese unterschwellige Würze, die alle diese Biere durchdringt, ohne dass sie sich nach vorne drängt. Im Geschmack ist der Gurkenkaiser nun deutlicher milder, was die Säure angeht, ohne dass Süße auftaucht. Aromatisch teilen sich nun Essiggurke und Zitrone das Geschmacksbild, der Dill bietet ihnen die Hauptrolle und zieht sich auf ein kleines Detail am Rande zurück. Der Verlauf ist kurz und knackig, danach geht es schnell zuende, ohne, dass ich das als negativ empfinden würde, es bleibt ein wieder mal sehr rezentes Bier mit einem faszinierenden, regional spezifischen Twist, und sowas liebe ich ja. Das Mundgefühl ist am Ende doch sehr trocken und leicht astringierend, das passt aber zum Gesamtbild. Ein tolles, ungewöhnliches Bier!
Klassische Biertrinker, die nicht gern experimentieren und nichts anderes als Pils mögen, werden an der Schneeeule Irmgard verzweifeln. Kein Hopfen wird verwendet, dafür ist das Bier mit Orangen-, Granatapfel- und Limonenschalen eingebraut, was das ganze natürlich noch saurer macht, und wird mit vergorener Ingwer-Malz-Lösung und Zitrus- und Granatapfelschalen aromatisiert. Kreativbier par excellence, würde ich sagen! Auch hier: Pastellgold, blass, volltrüb. Und über Schaum rede ich einfach gar nicht mehr ab jetzt, das ist sinnlos, und wird auch nicht erwartet. Der Geruch ist deutlich vom Ingwer getrieben, und als Wurzel kommt das auch ein bisschen erdig rüber. Man riecht eine gewisse exotische, fast schon orientalische Note, finde ich – wahrscheinlich als Ergebnis der Kombination von Granatapfel und Ingwer, beides sehr typische Gewürze in orientalischen Gerichten. Auch etwas Basilikum und Rosmarin meine ich zu entdecken, als Nebennoten. Der Geschmack ist ebenso dominiert vom Ingwer, das geht fast in Richtung der aktuell so beliebten hausgemachten Ingwer-Limetten-Limonaden bei vielen Restaurants, die etwas auf sich halten. Durch die Zugabe der Limonen- und Orangenschalen wird alles noch saurer, als man es eh von einer Weissen gewohnt ist, das astringiert am Gaumen schon deutlich und zieht einem die Spucke weg. Auch im Geschmack wirkt die Irmgard zunächst erdig, später orientalisch, und am Ende fühle ich mich, als hätte ich eine der von mir sehr geliebten sauren Zungen aus Fruchtgummi mit Brauseüberzug, die man kaum ertragen kann. Hier funktioniert das, aber mehr als eine will ich hintereinander nicht trinken. Die Schärfe des Ingwer ist vorhanden, aber eher dezent und besonders im Abgang und Nachklang zu spüren, ohne dass es wirklich feurig wirkt. Unterhaltsam!
Das letzte Bier ist schließlich die Schneeeule Hot Irmi, auch ohne Hopfen eingebraut – denn es handelt sich dabei um die eben probierte Irmgard, die noch zusätzlich mit Habaneros versetzt wurde. Blass maisfarben, naturtrüb und dabei blickdicht. Schaum entsteht nur beim Eingießen für ein paar Sekunden, dann bleiben wirklich nur vereinzelte Bläschen an der Glaswand übrig. In der Nase finden sich leichte Verjus-Noten, Viez und Cidre, gleichzeitig kommt aber eine erdige, vegetabile Seite dazu – sind das bereits die Habaneros? Im Gesamtbild entsteht ein Geruch, der mich irgendwie etwas an Glühwein erinnert, nicht so überwürzt wie die auf dem Weihnachtsmarkt, aber doch etwas verwandt. Der erste Schluck, und ja, es waren die Habaneros, sie definieren überraschenderweise auch sofort den Antrunk. Richtig natürlich und grün, mit einer chilihaften Aromatik und ordentlich Schärfe. Letztere ist dennoch nicht überwältigend für jemanden, der gern scharf isst, doch die Brauerin schränkt ein: „Berliner können mit Schärfe nicht so richtig umgehen, für die ist manchmal salzig schon scharf“, und für solche Trinker ist die Hot Irmi dann wirklich an der Grenze. Die Vegetabilität geht wunderbar mit Fruchtnoten einher, Apfel, Pfirsich, aber auch etwas Gurke und Rettich, ein sehr spannendes und unterhaltsames, sicherlich innovatives Geschmacksbild. Der Abgang ist dann von Säure und Schärfe geprägt, gerade die Schärfe klingt sehr lange nach und lässt den Gaumen eine ganze Weile glühen.
Das Fazit ist natürlich für mich als großem Sauerbierliebhaber positiv, alle Varianten gefallen mir einfach gut, das ist spannend und interessant. Und man unterstützt durch den eh schon angenehmen Konsum dieser Biere auch eine kleine, inhabergeführte Brauerei, die sich um Erhaltung einer aussterbenden Tradition bemüht. Die Kombination ist top, Leute, kauft Schneeeule!