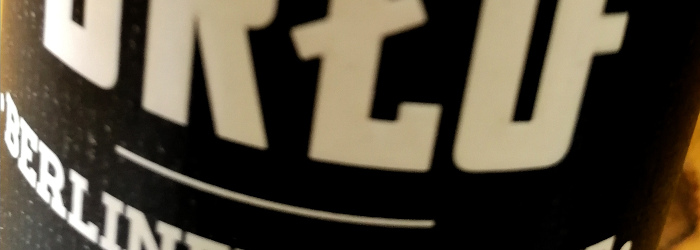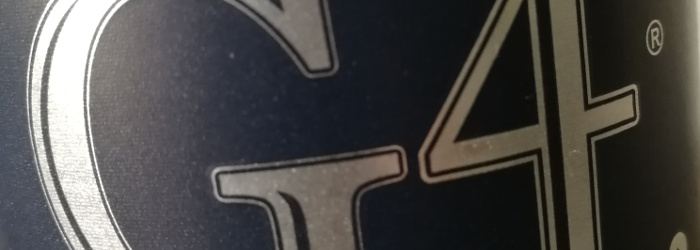Die moderne Gesellschaft ist zwiegespalten, in vielerlei Hinsicht. Auch beim Konsum von Genussmitteln zeigt sich das immer stärker. Tabak ist schon eine Weile ein Opfer dieses unaufhaltsamen Trends geworden, die schädlichen Aspekte von nicht unbedingt nötigen Dingen mehr zu berücksichtigen als die, wegen deren man überhaupt erst angefangen hat, sie zu sich zu nehmen; und das, obwohl es schon seit hundert Jahren oder mehr bekannt ist, was man sich mit Nikotin und Alkohol so antut. Bis vor ein paar Jahren war der Wunschasket allerdings in dem Dilemma, dass es keine Alternativen zum ungesunden Genuss gab, und so immer der Verzicht als einzige Lösung dieses Problems schien. Für Tabakfreunde ist es auch heute noch so, dass es nichts gibt, was das Erlebnis einer guten Zigarre oder sogar Zigarette (im Sinne des Genusses, nicht der Suchtbefriedigung) ersetzen könnte; beim Alkohol nähern wir uns dem dagegen schon langsam aber sicher an.
Bei Polly hat man inzwischen ein breites Portfolio an alkoholfreien Produkten entwickelt, das eben dieser Person, die auf schädlichen Alkohol verzichten will, dennoch aber dem Genuss nicht abgeneigt ist, einen Ausweg bieten soll. Der neueste Zugang ist hier der Polly Alcohol-Free French Aperitif, der, so vermute ich einfach mal frech, ein Ersatz für den weiterhin extrem beliebten Lillet Blanc darstellen soll. Ich dachte für diesen Fall einfach mal, dass ich für einen kleinen Abend unter Freunden, die gerne Lillet Wild Berry trinken, den French Aperitif mitbringe und ihn sozusagen in freier Wildbahn ausprobiere – es soll ja nicht nur der Gaumen des schon vorgeschulten Testers zu Wort kommen, sondern auch die tatsächliche Zielgruppe. Wie es ausging, erfahrt ihr am Ende des Artikels, erstmal will ich dann doch ein paar Notizen aus meinem Munde mitteilen.
Im Glas erkennt man, dass sich eine minimale Tönung zeigt, nichtmal strohig, eher crèmefarben. Die deutliche Viskosität, die sich beim Bewegen des Glases offenbart, weist für mich schonmal darauf hin, dass man hier nicht einfach nur aromatisiertes Wasser abgefüllt hat.
Die Nase gefällt mir auf eine verrückte Art und Weise sehr, auch wenn sie pur im Glas hart an der Grenze des Künstlichen liegt. Die Mischung aus Frucht, Gewürzen und Blumen erinnert schon sehr an Fruchtkaugummi. Dennoch ist da insbesondere diese an erdig-aromatische Parfüms erinnernde Gewürzkomponente, etwas Nelken, etwas Sternanis, etwas Muskat, dazu Zimt und Vanille, die mich wirklich sehr anspricht und alle Gedanken über Künstlichkeit wegwischt. Tatsächlich schnuppert sich der Polly French Aperitif für mich klar eher wie ein Parfüm als wie eine Spirituose – im positiven Sinne gesprochen. Sehr faszinierend!
Wie bei allen Polly-Produkten ist der Purgenuss nicht Ziel der Übung, darüber macht einem der Hersteller nie Hoffnungen; ganz so weit sind wir mit alkoholfreien Spirituosenalternativen dann halt doch nicht. Dennoch probiere ich nun pur. Und, ich bin überrascht, das funktioniert beim French Aperitif im Gegensatz zum bereits probierten Mexican Classic auch so. Weiche und volle Textur, ausgeprägte Aromen von reifem Pfirsich und Kirschen, dazu Zwetschgen, schöne orangige Zestigkeit mit einer milden, aber effektiven Bittere, frische Blumigkeit von Rosen und Veilchen, und spät dann eben diese Gewürzaspekte, die ich bei der Nase schon angesprochen hatte – das geht richtig gut zusammen, eine tolle Kombination aus interessanten Aromen. Im Abgang klingt noch angenehm herbe Bittere nach, mit Eindrücken von Grapefruit und Zimt.
Na, was soll ich sagen, hier hat man einen echten Treffer gelandet. Das hat wirklich den Charakter eines milden, leichten Aperitifs, kräftige Aromen – und man hat dabei nie das Gefühl, als wäre da kein Alkohol drin, etwas, was mich wirklich überzeugt. Blind hätte ich das niemals als alkoholfreien Aperitif eingeordnet, low-abv sicher, aber komplett alkoholfrei? Irre, das ist wirklich gut gemacht.
Die „Milk Bar“ war einst in Saarbrücken eine Institution – nicht nur, weil ich dort zum ersten Mal einen El-Dorado-Rum getrunken hatte vor langer Zeit, und nicht nur, weil von dort ausgehend das am Sankt-Johanner-Markt jedes Jahr das Primeur-Fest mit Hektolitern des jungen Beaujolais auszuufern drohte, sondern einfach weil der Besitzer ein cooler Typ ist, der immer eine Drinkidee für einen hatte, entspannt war, wenn man das Essen in die Bar bestellte, und als einzigen Feind die Nachbarin im gleichen Haus hatte, die sich über den Lärm beschwerte; sogar im Fernsehen wurde das ausgetragen als Saarbrücken’s zeitweiser Claim to Fame, die Milk Bar bot alles. Auch diesen speziellen Drink: der La Perla wird meist mit anderen Rezepten angegeben, so wie unten steht wurde er dort serviert. Ein Low-ABV-Drink, mit dem French Aperitif als Ersatz für den Lillet Blanc noch ein bisschen leichter. Für die anderen Zutaten gibt es ja heutzutage auch Alternativen – wer es komplett alkoholfrei probiert, lasse mich bitte wissen, wie es lief!
La Perla „Milk Bar Style“
1oz / 30ml Martini Rosso
½oz / 15ml Lillet Blanc
¼oz / 7ml Lime Cordial
1 Spritzer Himbeerlikör
Auf Eis rühren. Aufgießen mit Crémant.
[Rezept nach der Milk Bar, Saarbrücken]
Die Flasche ist im bereits bekannten Polly-Format, das Etikettendesign orientiert sich auch hier am flächigen, holzschnittartigen Stil, der gefällt und nicht übertrieben wirkt. Ich habe ein Paket bekommen, in dem neben der French-Aperitif-Flasche noch zwei Kleinflaschen Schweppes Wild Berry, das als Filler für den empfohlenen Signature Drink dienen soll, und zwei Gläser enthalten waren, stilsicher hält man sich auch bei dem Karton an das Corporate Design. Da weiß jemand, was sie oder er tut.



Zurück zum Anfang – bei dem schönen Abend kam die Mischung aus Polly French Aperitif und Schweppes Wild Berry, mit ordentlich Eis und nur leicht umgerührt und etwas dekoriert, ausgesprochen gut an. Alle waren verblüfft, dass es sich um einen alkoholfreien Drink handelt, keiner vermisste irgendwas, und der Geschmack hat alle voll überzeugt, manche haben direkt ihr Smartphone gegriffen und nach einer Bezugsquelle gesucht. Ein größeres Kompliment kann man einem Produkt wohl kaum machen!
Offenlegung: Ich danke Polly für die kosten- und bedingungslose Zusendung des Probierpakets mit dem French Aperitif.