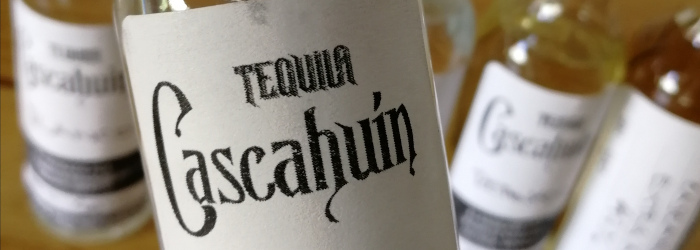In wenigen Tagen geht es los – ich reise zum zweiten Mal nach Mexiko. Vor fast einem Jahr war ich für México Selection by CMB in San Luis Potosí, dieses Jahr geht es mit Spirits Selection by CMB ins Herz der Tequilaproduktion nach Jalisco. Guadalajara und Puerto Vallarta werden die Aufenthaltsorte sein, und ich hoffe, wieder ähnlich viel zu erleben, denn Mexiko hat unglaublich viel zu bieten – die herausragende Gastfreundschaft, die lebendige und spannende Kultur, die beste Küche der Welt; und natürlich Tequila. Zur Vorbereitung trinke ich mich mit ein paar Samples ein, die schon viel zu lange bei mir herumstehen, die ich von Alex Huhn von der Mezcaleria Berlin als freundliche Beigabe bei einem Kauf erhalten habe. Es handelt sich um eine Produktreihe, die ich eh schon lange probieren wollte, nämlich Tequila Cascahuín Blanco, Blanco Tahona, Plata 48, Reposado und Extra Añejo.
Für alle fünf gilt, und das ist mir wichtig: Sie sind zertifiziert additiv-frei, garantiert durch die entsprechende Initiative von Tequila Matchmaker, auch wenn es diese aus Gründen (ich verweise hier gerne auf meinen neulich erschienenen Tequila-Artikel im Magazin Fizzz) inzwischen nicht mehr gibt. Aber auch darüber hinaus setzt man auf Qualität: Die Agaven werden erst nach frühestens 5 Jahren Aufwachszeit geerntet, und dann für ungefähr 25 Stunden in einem langsamen und schonenden Verfahren in Steinöfen gekocht, und ruhen schließlich einen Tag, um den gebildeten Agavenhonig ziehen zu lassen, bevor sie zerkleinert und gemahlen werden, in unterschiedlichen Verfahren. Die Fermentation erfolgt in offenen Tanks, ebenso in unterschiedlichen Verfahren, rein mit wilden Hefen der Umgebung. Einzelne Herstellungsdetails für die spezifischen Ausprägungen erwähne ich dann im Kontext. Und nun ran an die Fläschchen!
Besonders interessiert bin ich an den Unterschieden zwischen den drei ungereiften Varianten, die sich rein oberflächlich erstmal hauptsächlich über den Alkoholgehalt voneinander abgrenzen. Der Blanco ist auf 40% eingestellt, der Blanco Tahona auf 42%, und der Plata 48 auf 48%. Wir fangen mit dem Cascahuín Blanco an. Für ihn werden die Weber-Agavenherzen in einem Steinofen gekocht, mit einer Rollmühle zerkleinert, und in einem Verhältnis von 70:30 in Edelstahl- bzw. Zementtanks fermentiert. Der erste Destillationsvorgang („ordinario“) erfolgt in einer Edelstahlbrennblase mit Kupferschwanenhals, der zweite für den Feinbrand mit Abgrenzung von Vorlauf, Herz und Nachlauf in einer Brennblase vollständig aus Kupfer.
Klar, fehlerfrei und mit einer wirklich ordentlichen Viskosität versehen ist der optische Eindruck. Die Glaswand ist fett mit Artefakten versehen. Der Duft ist hochtypisch, man nimmt direkt die gekochte Agave wahr, sie dominiert alles. Direkt in Bezug aufs Basismaterial, mineralisch und mit leicht steinigen Aspekten, etwas vegetabil sogar mit viel Grünschnitt und einem Touch von Dill und grünem Tee. Darunter baut sich eine Basis aus Gewürzen auf, schwarzer Pfeffer, Kardamom, ein Anflug von Nelke. Sehr komplex, aber nicht wahllos, sondern klar auf die Agave zielgeführt.
Salzig und trocken vom Antrunk an, beide verstärken sich sogar im Verlauf. Eine subtile, sehr natürliche Süße gleicht einiges aus. Tabak und Tee sind die Geschmackseindrücke, herb und frisch, mit Anflügen von Minze und Lavendel, und einer Kopfnote von Grapefruitzeste. Die Textur ist voll, aber nicht schwer. Im Abgang wird der Cascahuín Blanco knochentrocken, mit leichter Astringenz, und einem warmen, pfeffrigen Kribbeln auf der Zunge, im Nachhall klingt die pure Agave lange und direkt nach.
Ein wirklich sauber strukturierter Tequila, direkt, mit Kraft und ein paar Kanten, die ihn aus der Easy-Drinking- in die Langsam-Genießen-Ecke schieben. Großartig, erwachsen, handwerklich makellos. So muss ein Blanco schmecken.
Die Unterschiede zwischen dem Blanco und dem Cascahuín Blanco Tahona sind subtil, aber vorhanden: erstens wird für die Zerkleinerung eben statt einer Stahlmühle die namensgebende Tahona verwendet; zweitens erfolgt die Fermentation vollständig in Zementgruben, und für die Fermentation wird die Bagasse, also die Fibern, mitverwendet. Auch der Blanco Tahona zeigt sich kristallklar und fehlerlos, das Schwenkverhalten ist ähnlich ansprechend mit erkennbarer Öligkeit und hübschen Beinen an der Glaswand.
Ich bilde mir ein, in der Nase eine frischere Variante zu finden als beim Blanco. Hier ist der Gewürzaspekt auch etwas mehr herausgearbeitet, man entdeckt Kardamomkapseln, Koriander und schwere Spearmint, Anflüge von Thymian und Rosmarin. Natürlich sind das Nebeneffekte, auch hier ist die Agave die klare Herrscherin der Aromen, sie wirkt aber edler eingebettet in ein Kräuterbett. Genauso geht es mir am Gaumen – die Aromen und die Textur wirken einen Hauch feiner im Antrunk, leichter und frischer; im Verlauf zeigt sich aber auch, dass der Blanco Tahona trotz der feineren Aromen auch mehr Pfeffrigkeit und Wucht am Gaumen herausbildet. Das wirkt frischscharf, minzig, mit milden Poblano-Chilis als Unterbau, vom Geschmack und dem Effekt her. Salzig und trocken ist er weiterhin, und im Abgang dann noch trockener als der Blanco, das muss man schon mögen, wenn einem die Spucke weggesaugt wird. Der Nachhall zeigt dann Kirsche und Pfirsich, ganz hintergründig nur.
Der Unterschied ist erkennbar, und der Blanco Tahona wirkt frischer und frecher als der im Vergleich nun fast gemütlich erscheinende Blanco. Beide bleiben dem Basismaterial sehr treu und interpretieren es nur leicht anders.
Auch für den Cascahuín Plata 48 gibt es Details zu berichten: Das Besondere hier ist die Destillation zur Abfüllstärke, und das Auslassen jeder Art von Filtration, ansonsten hält man sich an die Stahlmühle und eine Mischung aus Stahl- und Zementbehältnissen für die Fermentation, teilweise mit Fibern. Die Produktionsmenge ist auf 2500 Liter pro Batch begrenzt. Über das Aussehen des Plata 48 gibt es dagegen wenig neues zu erzählen, auch hier ist die erwartete Kristallklarheit vorhanden, und die Flüssigkeit schwappt schwer hin und her; die sich bildenden dickköpfigen Tropfen laufen langsam ab.
In der Nase kommt er aber überraschend anders an als seine beiden Vorgänger; hier ist alles viel weicher, dumpfer, runder, und ich meine, hier nun erstmal bananige Noten vorzufinden. Weiße Schokolade vielleicht, Nelken, und etwas dunklerer Tabak als zuvor. Die Agave ist weiterhin prägnant, aber viel weicher, tiefer, schwerer. Kokosfleisch finde ich, und etwas weniger mineralische Aspekte.
Die Textur wirkt viel milder, runder, voller, der Antrunk ist von Süße und Agave getrieben, mit feinen Fruchttönen und einem sehr kräuterigen Subtext. Jener verstärkt sich im Verlauf, zusammen mit einer sehr effektiven Schärfe, nun eher Jalapeño als Poblano. Die Trockenheit ist deutlich zurückgenommen, die Zunge kribbelt warm und ausgesprochen angenehm. Im Nachhall klingt das grüne Chili voll nach, in einem wirklich herrlichen Zusammenspiel mit der Agave, minimalster Floralität und in beeindruckender Länge und Breite.
Ah, ich kann mich nicht entscheiden, das sind alle drei herausragend gute Tequilas, die je einen anderen Aspekt betonen und darin wirklich das Beste zeigen, was diese Kategorie zu bieten hat. Wer die volle, reine Agave will, trinkt den Blanco; wer mehr auf edle Frische steht, den Blanco Tahona; und wer es mehr mild und perfekt integriert mag, den Plata 48. Wie gesagt, ich kann und will keine Entscheidung treffen. Egal, welchen man sich zulegt, man kauft die Crème-de-la-Crème des Tequila.
Wenden wir uns nun den holzgereiften Varianten zu – für mich gilt weiterhin, dass der ungereifte Tequila der König dieser Kategorie ist, aber gut gemachter Holzinteraktion bin ich auch hier nicht vollständig abgeneigt. Übersichtliche 6 bis 8 Monate reposiert der Tequila Cascahuín Reposado in Weißeichenfässern, die vorher schon 20 Jahre und mehr für Tequilareifung benutzt worden waren, da ist also keine erkennbare Fremdbelegung mehr vorhanden; ein Tequilafass, wie es sein soll.
Leichtes Stroh hat das Holz verursacht, eine dezente Tönung nur. Und auch in der Nase erkennt man sofort, dass hier behutsam vorgegangen wurde – der Tequila klingt weiterhin sehr direkt und voll nach der Weberagave, immer noch grünlich und vegetabil, nur die Mineralität ist etwas abgeschwächt, aber sogar das im für mich voll vertretbaren Maß. Dazu kommt nur wenig, und das schätze ich – eine leichte Vanillenote, ein bisschen Zuckerwatte, beides aber nicht künstlich wirkend.
Am Gaumen erlebt man eine sehr runde Dichtheit, klar texturiert, mit sehr angenehmer Viskosität. Das Holz präsentiert sich hier eher süßherb, nicht so süßgewürzig wie bei vielen anderen Fassreifungen, sondern eher ledrig und mit Anklängen von hellem Tabak. Ich entdecke Piment und Schwarzpfeffer, vielleicht etwas Sternanis, im späteren Verlauf feurigen Zimt. Die Struktur ist trocken, am Ende mildpfeffrig warm, kribbelnd und sehr lang, gegen Ende klingen noch gemüsige Erbsen, Mais, grüne Bohnen, Koriander und ein salzkaramelliges Erdnussgefühl nach.
Mit so einem Ausbau macht man sogar mich zum Fan eines Reposado, das muss ich sagen. Toll, mit Fingerspitzengefühl und Respekt der Agave gegenüber gemacht, wirklich grandios. Ich bin begeistert.
Ein Tequila, der sich die relativ neue Bezeichnung der längsten Alterungsstufe zulegen will, muss laut NOM 3 Jahre in Holz liegen; beim Tequila Cascahuín Extra Añejo legt man noch ein zusätzliches Jahr drauf; und 4 weitere Jahre wird es in alten „pipones“, also Bottichen, weiter stabilisiert.
Farblich hat sich im Vergleich zum Reposado nur unwesentlich etwas getan, ein helles Maisgelb ist entstanden, immer noch ehrlich und Zeuge des lange gebrauchten Holzes. Der Geruch hat sich dagegen deutlich entwickelt, klassischere Holzaromen wie Vanille, Zimt und Karotte sind nun erkennbar, aber auch hier weiterhin nicht alles andere übertünchend. Die Agave geht sicher nun in den Hintergrund, bleibt erkennbar. Insgesamt ist die Nase deutlich zurückgenommen in allen Aspekten, man sieht hier einfach, wie flüchtig die Agave sich im Holz verhält. Das ganze wirkt generischer, weniger expressiv.
Auch im Mund merkt man, dass die Kategorie sich selbst keinen Gefallen tut, einen so filigranen Brand wie Tequila so lange zu lagern. Süß und mildholzig, viel Honig, Zuckermelone, Nelken und Pfirsich beherrschen nun das Geschmacksbild, die Mineralität und Vegetabilität ist fast ganz weg. Immerhin bleibt die klare Struktur erhalten, auch wenn sie durch Süße nun schon etwas aufgeweicht ist. Gegen Ende kommt tanninige, sehr ausgeprägte Bittere in Kombination mit Trockenheit heraus, leicht kantig und aber auch spannend kontrastreich aufgesetzt im Vergleich zum Antrunk, sehr karottig dann, mit feiner zimtiger Würze und warmen Nachglühen.
Das ist natürlich immer noch als Tequila erkennbar, vor allem im Nachhall, wo sich die Agave nochmal streckt und dehnt; dennoch für mich schon an der Grenze dessen, was ich in dieser Kategorie mag. Doch, so klar muss ich das sagen – das ist mit Abstand der ehrlichste und beste Extra Añejo, den ich bisher im Glas hatte, da bleibt sich Cascahuín treu.
Das Eintrinken für die Arbeit als Juror bei Spirits Selection by CMB ist hiermit erfolgreich beendet; die Gefahr bei dieser Samplereihe besteht natürlich, dass man sich den Gaumen verdirbt, weil man sich an so herausragend gute Qualitäten nicht unbedingt gewöhnen sollte, um den schwächeren Tequilas noch eine ehrliche Chance zu lassen. Nun, das Risiko gehe ich gerne ein, ich reise jedenfalls mit einem guten Mundgefühl und schönen Agavenaromen nach Mexiko!
Offenlegung: Ich danke Mezcaleria Berlin für die kosten- und bedingungslose Zusendung der Samples dieser Tequilas.